
Ratgeber Schneeschuhwandern
Hast Du schonmal eine Schneeschuhwanderung unternommen? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Es wartet ein ideales Wintererlebnis für Groß und Klein auf Dich. Dafür muss man nicht zwangsläufig in den Alpen unterwegs sein. In schneereichen Wintern sind auch die hiesigen Mittelgebirge ein genialer Spielplatz, um sich mit Schneeschuhen in den Schnee zu stürzen. Mittelgebirge haben übrigens noch einen großen Vorteil gegenüber den Alpen oder anderen Gebirgsregionen. Hier kommen Lawinen nämlich so gut wie nie vor!
Schneeschuhe im Doorout Sortiment

TUBBS Flex ALP Herren
- Schneeschuh für jedes Terrain
- ActiveFit 2.0 Bindung für unterschiedlichste Schuhe
- Perfekter Halt beim Queren durch 3-D Seitenschienen
- Hochklappbare ActiveLift-Steighilfe
- Maximaler Grip durch die Viper 2.0 Frontzacken
- Natürliches Abrollen durch FlexTail & Torsion Deck
- Größe 29 bis max. 110 kg
- Größe 25 bis max. 90 kg

TUBBS Flex ALP Damen
- Schneeschuh für jedes Terrain
- ActiveFit 2.0 Bindung für unterschiedlichste Schuhe
- Perfekter Halt beim Queren durch 3-D Seitenschienen
- Hochklappbare ActiveLift-Steighilfe
- Maximaler Grip durch die Viper 2.0 Frontzacken
- Natürliches Abrollen durch FlexTail & Torsion Deck
- Größe 25w bis max. 90 kg
- Größe 21w bis max. 75 kg

TUBBS Flex TRK
- Einsteiger Schneeschuhe für Winterwanderungen
- Einfach zu bedienende Quick-Fit-Bindung
- ActiveLift-Steighilfe erleichtert die Anstiege
- Natürliches Abrollen durch FlexTail & Torsion Deck
- 3D-geformte Seitenschienen für besten Grip beim Queren
- Größe 24 bis max. 90 kg
- Größe 22 bis max. 75 kg

TUBBS Flex RDG
- Optimal für Wanderungen in moderatem Gelände
- CustomWrap-Bindung mit Boa-Verschlusssystem
- ActiveLift-Steighilfe erleichtert die Anstiege
- FlexTail lässt den Schuh natürlich abrollen
- 3D Seitenschienen bieten besten Grip beim Queren
- Größe 24 bis max. 90 kg
- Größe 22 bis max. 75 kg

TUBBS Flex HKE Kinder
- Ein Schneeschuh für Kinder und Jugendliche
- 9 bis 14 Jahre
- Einfach zu bedienende QuickLock2 Bindung
- ActiveLift-Steighilfe erleichtert die Anstiege
- FlexTail lässt den Schuh natürlich abrollen
- 3D Seitenschienen bieten sicheren Halt beim Queren
- Belastbar bis max. 75 kg

TUBBS Flex JR Kinder
- Speziell für 6- bis 10-jährige Kinder
- Composite-Deck mit Flex Tail™ Design
- QuickLock™-Bindung
- Abgerundete Frontzacken und Seitenschienen
- Einfache Handhabung der Ratschenbindung
- Weiches Schneeschuhende
- Belastbar bis max. 23 kg

ATLAS Helium Trail
- Robuster Schneeschuh für Winterwanderungen
- Wrapp Stretch-Bindung mit verstellbarem Riemen
- Flexibles Verdeck für ein natürliches Abrollgefühl
- Steighilfe entlastet die Wadenmuskulatur
- Helium Lamellen-System gegen Schneeablagerung am Schuh
- Größe 26 – 70 bis 115 kg
- Größe 23 bis max 70 kg
Was ist überhaupt ein Schneeschuhe und welche Arten gibt es?
Schneeschuhe sind ein geniales Hilfsmittel zur Fortbewegung bei hohen Schneelagen. Du hast in älteren Filmen vielleicht schonmal diese Tennischlägerartigen Gebilde gesehen, mit denen die Menschen früher durch den Schnee gelaufen sind. Dieses Konstrukt unter den Füßen, bzw. den Schuhen, verteilt das Gewicht einer Person auf eine größere Fläche, so dass man dadurch nicht so tief im Schnee versinkt. Somit kommt man bei viel Schnee mit Schneeschuhen schneller voran als ohne.
Heutzutage gibt es hochentwickelte Schneeschuh-Varianten von vielen namhaften Herstellern. Bei uns, wie oben gesehen, findest Du Modelle aus dem Hause Tubbs und Atlas. In der Regel bestehen moderne Schneeschuhe aus Aluminium oder Kunststoff. Auf die Unterschiede gehen wir im Folgenden nochmal näher ein.
Schneeschuhe mit Aluminiumrahmen
Wer hätte es gedacht? Wie die Überschrift schon verrät, bestehen diese Modelle aus einem Aluminiumrahmen, welcher mit einem stark belastbaren Kunststoffgewebe, dem sogenannten Deck, bespannt ist. Diese Bauweise wird häufig als „Classics“ bezeichnet und eignet sich ideal für Anfänger bis Fortgeschrittene in leichtem bis moderatem Gelände. Allerdings gibt es auch hier Modell für hochalpines Gelände.
Kunsstoffschneeschuhe
Während man bei den Aluminumrahmen von Classics spricht, gehören die Kunstsoffschneeschuhe zu den „Moderns„. Diese Schneeschuhe werden aus einem stabilen Kunststoffteil gefertigt und eignen sich, je nach Modell, für sportliche Touren in anspruchsvollem Gelände. Sie sind in der Regel etwas kleiner und leichter als Schneeschuhe mit Aluminumrahmen. Ideal also für Touren, bei denen auch das Gewicht eine Rolle spielt.
Bindungssysteme
Hier liest man in den Beschreibungen der unterschiedlichen Modelle gerne so begriffe wie Quick-Fit, HyperLink™ oder Wrapp™ MTN. Vereinfacht gesagt, kann man alle Bindungssysteme als Schnellspanner bezeichnen. Egal ob Lochband, Ratschensystem oder die Verwendung des beliebten BOA® Fit System. Eins haben alle gemein, sie sind super schnell angelegt und auch wieder vom Fuß abgeschnallt.
Steighilfen, Steigeisen und Co
Ein Rahmen mit Deck sowie eine geeignete Bindung machen noch lange keinen hochwertigen Schneeschuh aus. Hierzu bedarf es noch etwas mehr. Die Bindungen sind so gelagert, dass sich der Schneeschuh beim Laufen unterm Fuß bewegen kann. Wird das Gelände steiler oder kommt vereistes Gelände hinzu, kommen unterschiedliche Steighilfen zum Einsatz. Manche Modelle nutzen Aluminiumschienen mit gezackten Zähnen auf der Unterseite um Halt zu geben. Auf der Vorderseite der Bindungen kommen robuste Metalkrallen (ähnlich wie bei Steigeisen) zum Einsatz. Eine ausklappbare Fersenerhöhung erleichtert das Steigen in steilem Gelände.
Welches ist der richtige Schneeschuh für Dich?
- je größer das Gewicht des Schneeschuh-Gehers inklusive Ausrüstung, desto größer muss der Schneeschuh sein
- kleinere Schneeschuh-Modelle sind gut für steiles Gelände
- es gibt spezielle Damen- und Herrenmodelle
- auch für Kinder gibt es passende Schneeschuhe
- verbaute Frontzacken und Harscheisen sind ideal für steiles Gelände und bei eisigen Verhältnissen hilfreich
- schau Dir das Bindungssystem gut an und überlege Dir, ob Du es auch mit dicken Handschuhen bedienen kannst
Wie läuft man mit Schneeschuhen richtig?
Die richtige Schuhwahl für Schneeschuhtouren
Meine Empfehlung wären Schuhe der Kategorie B oder B/C. für Schneeschuhtouren in leichtem bis mittelschwerem Gelände. Diese Schuhe haben eine gewisse Schafthöhe, die Sohle ist relativ stabil und manche Modelle verfügen über einen Geröllschutzrand. Gescheite Winter-Wanderschuhe mit Fütterung halten die Füße an sehr kalten Tagen schön warm und können ebenfalls für leichte Touren genutz werden.
Bei Touren in alpinem Gelände oder gar auf Hochtouren darf es dann schon ein Schuh der Kategorie C oder D sein. Hier ist der Schaft noch höher, die Sohle deutlich stabiler und verwindungsarm. Die Wärmeregulation lässt sich über geeignete Socken gut steuern.
Die richtige Ausrüstung für Schneeschuhwanderungen
Schneeschuhe alleine machen noch keine gelungene Tour aus. Hierfür benötigst Du noch etwas mehr an Ausrüstung. Mit unserer Auflistung geben wir Dir eine Übersicht aller Materialien, die auf einer Schneeschuhtour wichtig sein können. Je nach Länge der Tour und aktueller Wetterlage kann und sollte diese Liste natürlich angepasst werden.
Bekleidung
- Hardshell-Regenjacke
- Tourenhose oder technische Trekkinghose
- Funktionsocken / Skisocken
- Funktionsshirt
- Funktionsunterhose lang
- Longsleeve
- Isolationsjacke
- Windweste
- Halstuch
- Handschuhe
- Mütze
- Gamaschen
- Wanderschuh / Winterstiefel
Hygiene / Apotheke
- Erste-Hilfe-Set
- Blasenpflaster
- Sonnencreme hoher UV-Schutz
- Lippenpflegestift mit UV-Schutz
- benötigte Medikamente
- Müllbeutel
- Toilettenpapier/Taschentücher
Ausrüstung
- Schneeschuhe
- Trekkingstöcke + Schneeteller
- Rucksack (20-30L) + Regenschutz
- Biwaksack
- Stirnlampe inkl. Ersatzbaterrien
- Sonnenbrille
- Gebietskarte 1 : 25000
- evtl. Kompass
- evtl. GPS-Gerät
- Handy + Ladekabel
- Tagesproviant
- Trinkblase / Trinkflasche
- Taschenmesser
- Sitzkissen
- Bargeld/EC-Karte/Kreditkarte
- Personalausweis / DAV Ausweis
für Alpine Touren
- Lawinenverschüttetengerät (LVS)
- Lawinensonde
- Schaufel
- aktueller Lawinenlagebericht
- Schneeschuhtourenführer
Schneeschuhtouren mit Kindern
Schneeschuh-Wanderungen sind nicht nur etwas für Erwachsene. Mit der richtigen Ausstattung kann hier sogar die ganze Familie Spaß im Schnee haben. Für Kids ab ca. 6 Jahren gibt es, wie oben schon erwähnt, eigene Schneeschuhe. Sind die Knripse doch noch etwas jünger, kann man sie zum Beispiel in einer Kraxe mit auf Tour nehmen. Und selbst für die ganzen Kleinen gibt es eine Möglichkeit dabei zu sein, wenn die Eltern auf Schneeschuh-Tour gehen wollen. Wir selber nutzen dafür den Sportrex 1 Kindersportwagen aus dem Hause Queridoo mit dem dazu passenden Ski & Hike Set. Ähnliche Kombinationen gibt es auch von Thule oder anderen Herstellern.
Solche Unternehmungen sind natürlich nichts für Alpines Gelände. Aber in schneesicheren Regionen gibt es auch so viele lohnenswerte Touren für die ganze Familie.
Weitere nützliche Infos zum Schneeschuhwandern
Du bist Dir nicht sicher ob Schneeschuhwandern etwas für Dich ist aber würdest es gerne mal ausprobieren? Dann informiere Dich bei Deiner Alpenverneins Sektion oder einer Sektion in Deiner Nähe. Dort bekommst Du bestimmt weitere Informationen.
Wenn Du einen Urlaub in den Bergen planst, findest Du eigentlich in allen Regionen Anbieter von geführten Schneeschuhwanderungen wie zum Beispiel im Allgäu. Recherchiere einfach ein bisschen im Internet und Du wirst sicher das richtige Angebot für Dich finden. In den meisten schneesicheren Urlaubsregionen kannst Du vor Ort auch die benötigte Ausrüstung zu fairen Preise ausleihen.
Allen, die eine Schneeschuh-Tour auf eigene Faust unternehmen wollen, kann ich für die Tourenplanung das Tourenportal auf Alpenvereinsaktiv.com empfehlen. Hier kann man sich über die Filterfunktion nur Schneeschuhtouren anzeigen lassen. Es gibt auch eine kostenlosen App in der die jeweilige Tour auch offline gespeichert werden kann. Unterwegs kann man dann jederzeit einen Blick auf die Karte werfen und sich dank GPS auch leiten lassen.
Die Karten des Alpenvereins können bei einer Tourenplanung ebenfalls hilfreich sein.
Da man bei Schneeschuhtouren aktiv in der Natur unterwegs ist, sollte man sich selbstverständlich Mutter Natur gegenüber auch respektvoll verhalten. Denn im Winter sind Flora und Fauna sehr störungsanfällig und reagieren mitunter empfindlich. Beim Alpenverein findest Du auf der Seite „Schone die Natur“ einen sehr gelungenen kurzen Ratgeber zu diesem Thema. Besser könnte ich es hier gar nicht wiedergeben.
Fazit: Schneeschuhwandern im Einklang mit der Natur
Du suchst eine Möglichkeit im Winter aktiv in der Natur unterwegs zu sein und willst die überfüllten Skipisten meiden, hast keine Lust auf Skilanglauf oder suchst eine neue Herausforderung? Dann ist eine Schneeschuhwanderung in ruhiger Natur mit ziemlicher Sicherheit genau das richtige für Dich. Egal ob in den Alpen oder den Mittelgebirgen. Überall gibt es unzählige und sehr lohnenswerte Touren. Nichts wie raus also! Man sieht sich draußen…
Du hast noch Fragen zum Thema Schneeschuhwandern oder möchtest unseren Lesern eine spezielle Tour ans Herz legen? Dann hinterlasse gerne einen Kommentar.

Stefan Feldpusch
Freelancer by doorout.com
Wenn es die Zeit zulässt, bin ich so oft es geht gerne aktiv draußen unterwegs. Egal ob Klettern, Bergsteigen, Wandern, Mountainbiken oder im Winter mit den Langlaufskiern. Im Sommer gerne mit dem Zelt oder dem Caddy-Camper unterwegs und noch dazu seit einigen Jahren Outdoor-Blogger mit Herz auf dem eigenen Blog www.see-you-on-the-outside.de, sowie als Klettertrainer beim DAV aktiv. Als Freelancer im Doorout-Team seit 2017.




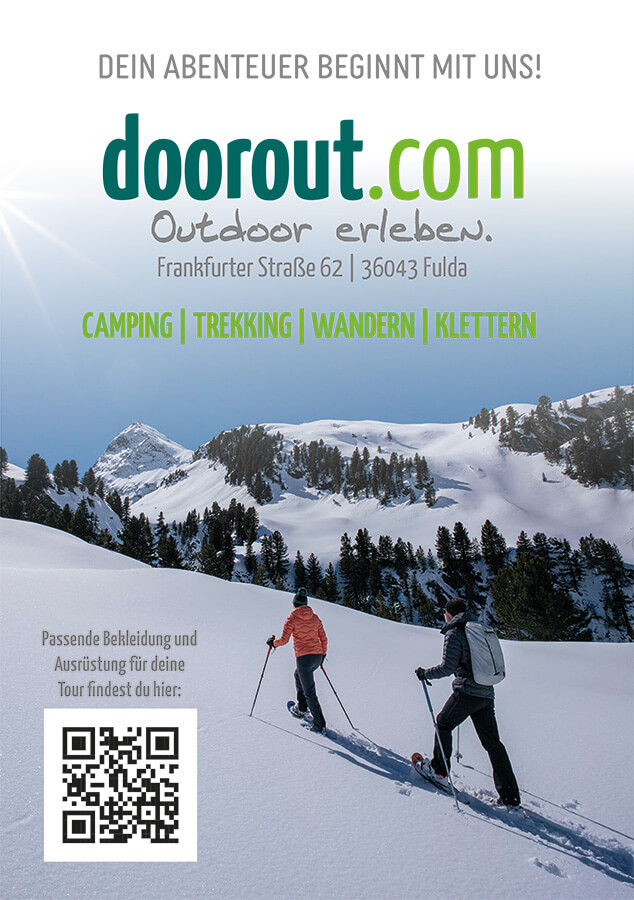



















































Letzte Kommentare